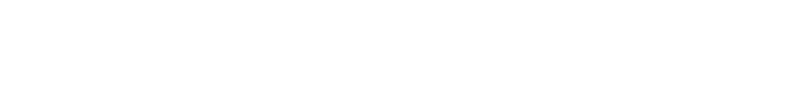Neuigkeiten - Übersicht
Erfolgreiche Re-Zertifizierung des „Herzinsuffizienzzentrums“ beim Herzteam Dortmund
Erfolgreiche Re-Zertifizierung des „Herzklappen (TAVI)-Zentrums“ am JoHo Dortmund
Erfolgreiche Re-Zertifizierung des „Vorhofflimmer-Zentrums“ beim Herzteam-Dortmund
Wir spenden für den guten Zweck!
5.000 Aortenklappen im JoHo eingesetzt
Der Ball rollt wieder - Fussball EM 2024